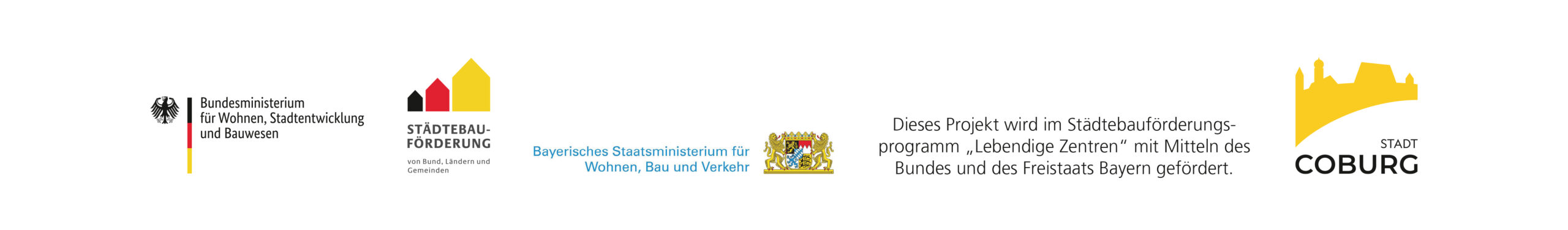Von Mauern und Menschen
Coburgs Hausgeschichten
Von Mauern und Menschen
Coburgs Hausgeschichten
Hausgeschichten
Hören & Entdecken
Was Sie dafür brauchen?
Lediglich ein Smartphone, auf dem Sie einen QR-Code auslesen können.
Wann ist die Tour zeitlich möglich?
Wann immer Sie Lust dazu haben, da die Audiotour eigenständig durchführbar ist.
Um was geht es genau?
Lauschen Sie Geschichten vergangener Tage von sieben ausgewählten Häusern. Wer hat in diesem Haus gelebt? Welche Schicksale haben sich dort abgespielt?
Wer hat sich das ausgedacht?
Die Wohnbau Stadt Coburg als Sanierungsträger der Stadt gemeinsam mit kreativer Unterstützung vom Coburger Designforum Oberfranken (CDO).
Was ist der Sinn dahinter?
Mit diesem Projekt wird nicht nur die historische Bedeutung der Gebäude vermittelt, sondern auch das Bewusstsein für den Wandel und Erhalt des Stadtbildes gestärkt.
Kann alles Erzählte für bare Münze genommen werden?
Die Hausgeschichten sind inspiriert von wahren Begebenheiten und historischen Fakten, aber erzählt mit einem Augenzwinkern und einem Funken Fantasie.
An welchen Häusern sind an der Fassade QR-Codes angebracht?
Schenkgasse 4
Metzgergasse 1
Hinterm Marstall 6
Ketschengasse 42
Schenkgasse 1 (Fahrradscheune)
Gewerbehof/Parkhaus Mauer
Park 4
Station 1
Schenkgasse 4
Lesen statt hören
Das Geheimnis der offenen Laube
Es war ein bewegter Herbsttag im Jahr 1629. Nun stand die Witwe, Christina Schultheiß, in der offenen Laube im Obergeschoss des Hauses. Der vertraute Geruch von gegerbten Tierhäuten umwehte sie, ein Geruch, der untrennbar mit ihrem Leben verbunden war. Von hier oben überblickte sie das geschäftige Treiben im Werkhaus.
Meisterknecht Hans beugte sich über einen Bottich, seine Bewegungen erfahren und routiniert. Christina rief hinunter, ihre Stimme fest, aber mit einem Anflug von Sorge: „Hans, sind die feinen Rindsleder-Handschuhe für Meister Weber bald fertig? Er drängt auf die Lieferung.“
Hans blickte auf, seine Hände feucht. „Fast, Frau Schultheiß. Die Gerbung ist fast abgeschlossen. Nach dem letzten Bad in der Lohe müssen sie noch lange trocknen, aber der Hauptteil ist getan. Es wird noch einige Zeit dauern, bis sie zur Verarbeitung bereit sind. Aber die Qualität wird hervorragend sein.“
Christina nickte. Die offene Laube war ein Ort zum Trocknen der wertvollen Häute, aber anders als bei vielen anderen Gerbereien in Coburg waren Werk- und Wohnhaus hier unter einem gemeinsamen Dach vereint, und die offene Konstruktion erlaubte einen direkten Austausch zwischen den Arbeitsbereichen.
Manchmal stand Christina hier oben und dachte an ihren verstorbenen Mann. Er hatte dieses Haus 1618 erbauen lassen, ein stolzes Zeugnis seines Fleißes. Nun lag es an ihr, sein Erbe zu bewahren und die Gerberei durch die schwierigen Zeiten zu führen.
Sie erzählt Jakob von der Zeit, als die Gerbereien hier am Rande der Stadt angesiedelt wurden, nahe dem Hahnfluss, dessen Wasser so lebensnotwendig für ihre Arbeit war.
Heute, nach der liebevollen Sanierung durch die Coburger Wohnbau, ist die Schenkgasse 4 ein modernes Wohn- und Geschäftshaus. Doch wenn man genau hinsieht, kann man vielleicht noch den Geist der Gerber spüren – denn die Schenkgasse 4 ist eines der wenigen seiner Art in einem für Coburg früher bedeutendem Handwerk.


Station 2
Metzgergasse 1
Lesen statt hören
Ein Haus erzählt von Handwerk und verborgenen Schätzen
Stellen Sie sich vor, es ist das Jahr 1670. Metzger Conrad Quenzlein geht seiner Arbeit im Haus Metzgergasse 1 nach. Wie mag sein Alltag ausgesehen haben? Das Schärfen der Messer, das Zerlegen des Fleisches, der Austausch mit den Kunden in der Gasse, die damals noch ihrem Namen alle Ehre machte – die „Fleischgasse“ wurde erst 1468 zur Metzgergasse.
Einige Jahrzehnte später, wir schreiben das frühe 18. Jahrhundert. Schuster Michael Winter bewohnt das Haus. Vielleicht sitzt er an seinem Leisten am Fenster, das Klappern von Hammer und Nagel hallt durch die Räume. „Die Sohle muss ordentlich vernäht sein, das hält länger“, murmelt er vor sich hin, während er einen neuen Schuh für einen Coburger Bürger fertigt. Nur wenige Jahre später zieht Schneider Heinrich Birnstiel ein. Stellen Sie sich vor, wie Stoffe zugeschnitten und feine Nähte gesetzt werden. Die Gasse wandelt sich, Handwerker unterschiedlichster Gewerke ziehen ein.
Springen wir ins 19. Jahrhundert. Tünchermeister Johann Christian Rehdanz bezieht 1837 die Metzgergasse 1. Fünfzehn Jahre später lebt die Familie Beyersdorf hier. Eleonore Beyersdorf ist die Frau des Tünchermeisters. Im Jahr 1989 führt die Coburger Wohnbau als Sanierungsträger der Stadt Coburg Sanierungsarbeiten durch.
Zum Vorschein kommen rund 30 original verpackte Tapetenrollen mit verschiedenen Bordüren, kleine Hefte mit Farbrezepturen und sogar ein Entwurf für ein herrschaftliches Zimmer mit einem beeindruckenden Löwenmotiv. Die Funde lassen auf die Arbeit des Tünchermeisters Rehdanz oder seines Umfelds schließen.
Doch die Überraschungen gehen weiter. Zahlreiche Schulbücher werden gefunden. „Unglaublich, was man hier alles findet!“, staunt ein Architekt, als die Funde vorsichtig geborgen werden. Die besonderen Zeugnisse der Vergangenheit werden an die städtischen Sammlungen weitergegeben, um für die Nachwelt bewahrt zu werden.
Anfang des 20. Jahrhunderts zieht ein Gärtner, Philipp Fischer, in das Haus, gefolgt von Bäckermeister Peter Wagner im Jahr 1909. Interessanterweise war auch im benachbarten Eckhaus Judengasse 7 das Bäckerhandwerk zu Hause.
Die Metzgergasse 1 und ihre Umgebung erzählen so auf faszinierende Weise von den Menschen, die hier lebten und arbeiteten, von ihrem Handwerk und von den kleinen und großen Geschichten, die sich hinter den Mauern eines alten Hauses verbergen.
Station 2
Metzgergasse 1
Lesen statt hören
Ein Haus erzählt von Handwerk und verborgenen Schätzen
Stellen Sie sich vor, es ist das Jahr 1670. Metzger Conrad Quenzlein geht seiner Arbeit im Haus Metzgergasse 1 nach. Wie mag sein Alltag ausgesehen haben? Das Schärfen der Messer, das Zerlegen des Fleisches, der Austausch mit den Kunden in der Gasse, die damals noch ihrem Namen alle Ehre machte – die „Fleischgasse“ wurde erst 1468 zur Metzgergasse.
Einige Jahrzehnte später, wir schreiben das frühe 18. Jahrhundert. Schuster Michael Winter bewohnt das Haus. Vielleicht sitzt er an seinem Leisten am Fenster, das Klappern von Hammer und Nagel hallt durch die Räume. „Die Sohle muss ordentlich vernäht sein, das hält länger“, murmelt er vor sich hin, während er einen neuen Schuh für einen Coburger Bürger fertigt. Nur wenige Jahre später zieht Schneider Heinrich Birnstiel ein. Stellen Sie sich vor, wie Stoffe zugeschnitten und feine Nähte gesetzt werden. Die Gasse wandelt sich, Handwerker unterschiedlichster Gewerke ziehen ein.
Springen wir ins 19. Jahrhundert. Tünchermeister Johann Christian Rehdanz bezieht 1837 die Metzgergasse 1. Fünfzehn Jahre später lebt die Familie Beyersdorf hier. Eleonore Beyersdorf ist die Frau des Tünchermeisters. Im Jahr 1989 führt die Coburger Wohnbau als Sanierungsträger der Stadt Coburg Sanierungsarbeiten durch.
Zum Vorschein kommen rund 30 original verpackte Tapetenrollen mit verschiedenen Bordüren, kleine Hefte mit Farbrezepturen und sogar ein Entwurf für ein herrschaftliches Zimmer mit einem beeindruckenden Löwenmotiv. Die Funde lassen auf die Arbeit des Tünchermeisters Rehdanz oder seines Umfelds schließen.
Doch die Überraschungen gehen weiter. Zahlreiche Schulbücher werden gefunden. „Unglaublich, was man hier alles findet!“, staunt ein Architekt, als die Funde vorsichtig geborgen werden. Die besonderen Zeugnisse der Vergangenheit werden an die städtischen Sammlungen weitergegeben, um für die Nachwelt bewahrt zu werden.
Anfang des 20. Jahrhunderts zieht ein Gärtner, Philipp Fischer, in das Haus, gefolgt von Bäckermeister Peter Wagner im Jahr 1909. Interessanterweise war auch im benachbarten Eckhaus Judengasse 7 das Bäckerhandwerk zu Hause.
Die Metzgergasse 1 und ihre Umgebung erzählen so auf faszinierende Weise von den Menschen, die hier lebten und arbeiteten, von ihrem Handwerk und von den kleinen und großen Geschichten, die sich hinter den Mauern eines alten Hauses verbergen.

Station 3
Hinterm Marstall 6
Lesen statt hören
Ein Haus voller Handwerk und Familienzwist
„In diesem Haus war einst das Schneiderhandwerk zu Hause“, flüstert der Wind. Johann Günther arbeitete hier, und nach seinem Tod 1934 erhielt seine Tochter Anna die Nutznießung des Grundstücks.
Doch es gab auch dunklere Zeiten. Ein Mieter namens Max Günther – dessen genaue Verwandtschaft zu Anna unklar ist – sorgte für Unruhe. „Ein schikanös veranlagter Mensch mit hinterhältigem Charakter“, schrieb Annas Bruder Ernst in seinen Briefen.
Ernst: „Anna, dieser Max treibt dich noch ins Grab! Ständig Mietstreitigkeiten, Beleidigungen, sogar Handgreiflichkeiten!“ Anna: „Ich weiß, Ernst. Ich habe keine ruhige Minute mehr. Er nutzt seine Privatwohnung als Werkstatt, beschädigt den Kachelofen… Und die Briefe in meine Kur nach Oberhof sind auch keine Erholung!“
Max Günther kürzte eigenmächtig die Miete, hetzte andere Mieter auf und trieb Anna zur Verzweiflung. Die Streitigkeiten eskalierten so sehr, dass Ernst Günther sogar die Polizei einschalten wollte.
Das Ende bleibt offen
Wie dieser Familienzwist ausging? Die Überlieferungen schweigen …
Doch die Geschichte dieses Hauses ist noch vielschichtiger. Das prächtige Wappen-Portal am Eingang, datiert auf 1630, erinnert an eine Zeit, als hier Büchsenmacher wie Röhrlein ihre Werkstatt hatten. Diese Mauern haben also nicht nur Wohnraum geboten, sondern auch eine ganze Dynastie von Büchsenmachern und die Spuren verschiedenster Handwerksberufe getragen.
Eines ist sicher: Dieses Haus hat viel erlebt – von Handwerk und Familienglück bis hin zu Streit und Intrigen. Wenn Sie also das nächste Mal Hinterm Marstall 6 stehen, denken Sie an die vielen Geschichten, die in seinen Mauern verborgen liegen.


Station 4
Ketschengasse 42
Lesen statt hören
Jedes Detail zählt!
Stellen Sie sich vor, Sie stehen in der Ketschengasse, da, wo der Platz sich gemütlich weitet. Der Blick fällt auf Nummer 42 – ein Haus mit Ecken und Kanten, aber auch mit einer Seele, die Geschichten flüstert. Johann Anton Sturm, ein Leineweber mit Wurzeln in einer bierbrauenden Familie (ja, genau die!), ließ es 1800 umbauen. Aber die Geschichte dieses Fleckchens Erde reicht noch weiter zurück, denn seine Familie hatte den Altbau schon 1793 in ihre Obhut
genommen. Der älteste Teil des Hauses reicht sogar in die Mitte des 16. Jahrhunderts zurück.
Sieben Fensterachsen blicken neugierig auf die Gasse, ein Zwerchhaus lugt keck aus dem Dach. Und dieses Haus, liebe Leute, es ist ein Gegengewicht! Drüben, die Nummer 28, auch so ein Platzgucker, markiert das nördliche Ende des Häuserblocks. Unser Haus hier, die 42, mit seiner clever versetzten Fassade und dem Uwerhaus, das seit 1903 von Gauben flankiert wird, schummelt sich optisch sogar ein Giebeldach vor – trotz gleicher Höhe mit den Nachbarn. Clever, oder?
Wenn man in den Archiven blättert, da staunt man. Im 19. Jahrhundert klapperten hier die Webstühle. Später, ab 1907, duftete es nach frischen Lebensmitteln, als die Familie Schramm ihren Laden eröffnete. Aber halt! Vor dem Duft kam der Staub: Johann Schramm ließ 1902 das Haus zur Schreinerei umbauen. Otto Leheis schwang den Hammer, und später legte Witwe Schramm noch Hand an.
„Ach, die Schaufenster!“, höre ich Reiner Wessels von der Sanierungsabteilung der WSCO seufzen, als ich ihn treffe. „1907 kam das erste rein, ganz asymmetrisch. Bei der Sanierung haben wir das zum Glück wieder in Einklang gebracht!“ Und dann das Tor! 1987 riss man das rechte Schaufenster auf, um ein Tor hineinzuzwängen. „Gott sei Dank“, lacht Wessels, „haben wir das auch wieder rückgängig gemacht!“
Zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert muss hier ein reges Treiben geherrscht haben. Mal war’s eine Korbwarenfabrik, dann wieder was anderes. Ständiges An- und Umbauen, das war hier die Devise.
„Dieses Haus“, erzählt mir Wessels mit leuchtenden Augen, „hat eine bewegte Geschichte. Wir haben versucht, so viel wie möglich davon zu bewahren.“ Er zeigt auf einen knarzenden Holzboden. „Original! Und dieses Treppengeländer, die alten Balken, sogar die ein oder andere Tür – alles Zeugen vergangener Zeiten.“
Er wischt sich imaginären Staub von der Stirn. „Es war ein Balanceakt. Ständig stießen wir auf Überraschungen.“ Er grinst. „Dieser überkragende Südgiebel zum Beispiel! Der hing mehr oder weniger in der Luft. Aber unsere Stahlkonstruktion hat ihn gerettet!“
Auch die 21 regionalen Firmen, die an der Sanierung beteiligt waren, hatten ihren Spaß. „Keine Wohnung gleicht der anderen“, erklärt Wessels. „Verschiedene Schnitte, unterschiedliche Deckenhöhen…“ Aber ein Detail zieht sich wie ein roter Faden durchs ganze Haus – im wahrsten Sinne des Wortes: die knallrote Farbe der Haustür! Und auch das Treppengeländer und der Laubengang zum Innenhof leuchten in diesem Rot, ein frecher Kontrast zum Grün der
Fassade. „Das war historisch schon so!“, zwinkert Wessels.
Heute? Heute ist die Ketschengasse 42 ein Schmuckstück. Ein Haus, das atmet, das erzählt. Ein Haus mit vielen Besitzern und noch viel mehr Geschichten. Ein Haus mit Vergangenheit und Zukunft – mitten in Coburg.
Station 4
Ketschengasse 42
Lesen statt hören
Jedes Detail zählt!
Stellen Sie sich vor, Sie stehen in der Ketschengasse, da, wo der Platz sich gemütlich weitet. Der Blick fällt auf Nummer 42 – ein Haus mit Ecken und Kanten, aber auch mit einer Seele, die Geschichten flüstert. Johann Anton Sturm, ein Leineweber mit Wurzeln in einer bierbrauenden Familie (ja, genau die!), ließ es 1800 umbauen. Aber die Geschichte dieses Fleckchens Erde reicht noch weiter zurück, denn seine Familie hatte den Altbau schon 1793 in ihre Obhut
genommen. Der älteste Teil des Hauses reicht sogar in die Mitte des 16. Jahrhunderts zurück.
Sieben Fensterachsen blicken neugierig auf die Gasse, ein Zwerchhaus lugt keck aus dem Dach. Und dieses Haus, liebe Leute, es ist ein Gegengewicht! Drüben, die Nummer 28, auch so ein Platzgucker, markiert das nördliche Ende des Häuserblocks. Unser Haus hier, die 42, mit seiner clever versetzten Fassade und dem Uwerhaus, das seit 1903 von Gauben flankiert wird, schummelt sich optisch sogar ein Giebeldach vor – trotz gleicher Höhe mit den Nachbarn. Clever, oder?
Wenn man in den Archiven blättert, da staunt man. Im 19. Jahrhundert klapperten hier die Webstühle. Später, ab 1907, duftete es nach frischen Lebensmitteln, als die Familie Schramm ihren Laden eröffnete. Aber halt! Vor dem Duft kam der Staub: Johann Schramm ließ 1902 das Haus zur Schreinerei umbauen. Otto Leheis schwang den Hammer, und später legte Witwe Schramm noch Hand an.
„Ach, die Schaufenster!“, höre ich Reiner Wessels von der Sanierungsabteilung der WSCO seufzen, als ich ihn treffe. „1907 kam das erste rein, ganz asymmetrisch. Bei der Sanierung haben wir das zum Glück wieder in Einklang gebracht!“ Und dann das Tor! 1987 riss man das rechte Schaufenster auf, um ein Tor hineinzuzwängen. „Gott sei Dank“, lacht Wessels, „haben wir das auch wieder rückgängig gemacht!“
Zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert muss hier ein reges Treiben geherrscht haben. Mal war’s eine Korbwarenfabrik, dann wieder was anderes. Ständiges An- und Umbauen, das war hier die Devise.
„Dieses Haus“, erzählt mir Wessels mit leuchtenden Augen, „hat eine bewegte Geschichte. Wir haben versucht, so viel wie möglich davon zu bewahren.“ Er zeigt auf einen knarzenden Holzboden. „Original! Und dieses Treppengeländer, die alten Balken, sogar die ein oder andere Tür – alles Zeugen vergangener Zeiten.“
Er wischt sich imaginären Staub von der Stirn. „Es war ein Balanceakt. Ständig stießen wir auf Überraschungen.“ Er grinst. „Dieser überkragende Südgiebel zum Beispiel! Der hing mehr oder weniger in der Luft. Aber unsere Stahlkonstruktion hat ihn gerettet!“
Auch die 21 regionalen Firmen, die an der Sanierung beteiligt waren, hatten ihren Spaß. „Keine Wohnung gleicht der anderen“, erklärt Wessels. „Verschiedene Schnitte, unterschiedliche Deckenhöhen…“ Aber ein Detail zieht sich wie ein roter Faden durchs ganze Haus – im wahrsten Sinne des Wortes: die knallrote Farbe der Haustür! Und auch das Treppengeländer und der Laubengang zum Innenhof leuchten in diesem Rot, ein frecher Kontrast zum Grün der
Fassade. „Das war historisch schon so!“, zwinkert Wessels.
Heute? Heute ist die Ketschengasse 42 ein Schmuckstück. Ein Haus, das atmet, das erzählt. Ein Haus mit vielen Besitzern und noch viel mehr Geschichten. Ein Haus mit Vergangenheit und Zukunft – mitten in Coburg.

Station 5
Schenkgasse 1
Lesen statt hören
Die Geschichte von Andres‘ Stadel
Es war um das Jahr 1730, als Gerbermeister Andres Röhrig, ein geschäftiger Mann und Besitzer des Hauses Steinweg 47, beschloss, für sein Anwesen Steinweg 45 ein praktisches Rückgebäude zu errichten. Ein einfacher, aber solider Stadel sollte es sein, mit einem schützenden Satteldach.
Die Handwerker zimmerten fleißig das Fachwerk, und bald stand der eingeschossige Bau mit seinem mittig platzierten, zweiflügeligen Tor an der langen Seite.
Können Sie die Szene vor Ihrem inneren Auge sehen? Andres, vielleicht mit wettergegerbtem Gesicht und Lederschürze, wie er zufrieden den Baufortschritt betrachtet?
Einige Jahrzehnte später, vielleicht ein Jahrhundert, wer weiß das schon so genau, klapperten keine Pferdekarren mehr durch das große Tor. Stattdessen lagerte hier Heu für das Vieh der wechselnden Besitzer, vielleicht auch Werkzeug und andere Güter.
Springen wir ins 20. Jahrhundert. Ein neuer Wind weht in der Schenkgasse. Adolf Krug, ein Hofkürschnermeister, lebte und arbeitete hier. Im Dachgeschoss seines Anwesens lagerten nun keine landwirtschaftlichen Erzeugnisse mehr.
Stattdessen kaufte und verarbeitete Herr Krug eine Vielfalt an Häuten und Fellen. Darunter waren nicht nur Rind-, Ross-, Hirsch- und Ziegenhäute, sondern auch viele andere, sogar exotische Leder und Felle aus aller Welt. ‚Schau mal, Lieselotte‘, mag er zu seiner Frau gesagt haben, als er ihr eine feine Fellauswahl zeigte, ‚diese hier sind besonders für den Wintermantel der Baronin geeignet.‘ Oder vielleicht präsentierte er ihr stolz eine neue Nähmaschine, ein
Wunderwerk der Technik für seine Werkstatt. ‚Damit, meine Liebe, werden unsere Nähte noch feiner!‘
Lange lag der Stadel im Dornröschenschlaf, Efeu rankte an den alten Mauern empor, fast vergessen im Herzen der Stadt.
Heute ist aus diesem einstigen Stadel ein modernes Fahrradparkhaus geworden. Wo einst Felle lagerten und dann Autos parkten, finden nun Fahrräder einen sicheren und trockenen Platz. Ein Ort des Wandels, der aber auf den Fundamenten seiner Geschichte ruht.


Station 6
Gewerbehof/Parkhaus Mauer
Lesen statt hören
Ein visionärer Ansatz: Das Parkhaus als integrierter Bestandteil der Innenstadt
In den frühen 1970er Jahren stand Coburg vor einem Dilemma: Zunehmender Individualverkehr belastete die historische Innenstadt, während gleichzeitig der Zustand der dort vorhandenen Wohnungen ungenügend war. Der Coburger Stadtrat fasste einen weitreichenden Entschluss: Die westliche Innenstadt sollte revitalisiert werden, mit dem Ziel, Wohnen, Arbeiten, Grünflächen und dringend benötigte Parkplätze intelligent miteinander zu verbinden. Das Parkhaus Mauer mit seinem integrierten Gewerbehof war das Herzstück dieses visionären Ansatzes.
Betrachten Sie die städtebauliche Idee hinter diesem Projekt.
Anstatt das Parkhaus als einen isolierten, funktionalen Bau außerhalb des Stadtbildes zu errichten, wählte man einen integrativen Ansatz. Soweit das Parkhaus oberirdisch sichtbar ist, wurde es bewusst mit „eigenen architektonischen Mitteln in die Umgebung eingebunden, ohne versteckt worden zu sein“, wie es in den Unterlagen heißt. Auch wenn die architektonische Sprache der 1970er Jahre heute diskutiert wird, so war die Intention klar: Ein modernes Bauwerk sollte sich in den historischen Kontext einfügen und gleichzeitig seine Funktion als notwendige Infrastruktur erfüllen.
Der Gewerbehof, der räumlich und konzeptionell mit dem Parkhaus verbunden wurde, unterstrich diesen integrativen Gedanken. Er bot Raum für Gewerbetreibende und Handwerksbetriebe und trug so dazu bei, die traditionelle Mischung von Wohnen und Arbeiten in der Innenstadt wiederzubeleben. Dieser Ansatz war seiner Zeit voraus und zielte darauf ab, einer reinen Funktionsgliederung der Stadt entgegenzuwirken. Ein wichtiger Aspekt der architektonischen Gestaltung war auch die Berücksichtigung der Fußgänger. Die Schaffung von Fußgängerzonen und das Angebot an Kundenparkplätzen im Parkhaus Mauer sollten die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt erhöhen und den Bürgern wieder einen attraktiven Lebensraum bieten. Die Verkehrsberuhigung war somit ein integraler Bestandteil des architektonischen Gesamtkonzepts.
Das Ensemble Parkhaus Mauer und Gewerbehof ist somit ein faszinierendes Beispiel für eine städtebauliche Vision, die darauf abzielte, moderne Bedürfnisse mit dem historischen Kontext in Einklang zu bringen. Es verdeutlicht, wie Architektur nicht nur funktionale Räume schafft, sondern auch wegweisende Gedanken transportieren und die Entwicklung einer Stadt maßgeblich prägen kann. Das Parkhaus ist dafür 1975 mit dem Deutschen Bauherrenpreis ausgezeichnet worden.
Station 6
Gewerbehof/ Parkhaus Mauer
Lesen statt hören
Ein visionärer Ansatz: Das Parkhaus als integrierter Bestandteil der Innenstadt
In den frühen 1970er Jahren stand Coburg vor einem Dilemma: Zunehmender Individualverkehr belastete die historische Innenstadt, während gleichzeitig der Zustand der dort vorhandenen Wohnungen ungenügend war. Der Coburger Stadtrat fasste einen weitreichenden Entschluss: Die westliche Innenstadt sollte revitalisiert werden, mit dem Ziel, Wohnen, Arbeiten, Grünflächen und dringend benötigte Parkplätze intelligent miteinander zu verbinden. Das Parkhaus Mauer mit seinem integrierten Gewerbehof war das Herzstück dieses visionären Ansatzes.
Betrachten Sie die städtebauliche Idee hinter diesem Projekt.
Anstatt das Parkhaus als einen isolierten, funktionalen Bau außerhalb des Stadtbildes zu errichten, wählte man einen integrativen Ansatz. Soweit das Parkhaus oberirdisch sichtbar ist, wurde es bewusst mit „eigenen architektonischen Mitteln in die Umgebung eingebunden, ohne versteckt worden zu sein“, wie es in den Unterlagen heißt. Auch wenn die architektonische Sprache der 1970er Jahre heute diskutiert wird, so war die Intention klar: Ein modernes Bauwerk sollte sich in den historischen Kontext einfügen und gleichzeitig seine Funktion als notwendige Infrastruktur erfüllen.
Der Gewerbehof, der räumlich und konzeptionell mit dem Parkhaus verbunden wurde, unterstrich diesen integrativen Gedanken. Er bot Raum für Gewerbetreibende und Handwerksbetriebe und trug so dazu bei, die traditionelle Mischung von Wohnen und Arbeiten in der Innenstadt wiederzubeleben. Dieser Ansatz war seiner Zeit voraus und zielte darauf ab, einer reinen Funktionsgliederung der Stadt entgegenzuwirken. Ein wichtiger Aspekt der architektonischen Gestaltung war auch die Berücksichtigung der Fußgänger. Die Schaffung von Fußgängerzonen und das Angebot an Kundenparkplätzen im Parkhaus Mauer sollten die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt erhöhen und den Bürgern wieder einen attraktiven Lebensraum bieten. Die Verkehrsberuhigung war somit ein integraler Bestandteil des architektonischen Gesamtkonzepts.
Das Ensemble Parkhaus Mauer und Gewerbehof ist somit ein faszinierendes Beispiel für eine städtebauliche Vision, die darauf abzielte, moderne Bedürfnisse mit dem historischen Kontext in Einklang zu bringen. Es verdeutlicht, wie Architektur nicht nur funktionale Räume schafft, sondern auch wegweisende Gedanken transportieren und die Entwicklung einer Stadt maßgeblich prägen kann. Das Parkhaus ist dafür 1975 mit dem Deutschen Bauherrenpreis ausgezeichnet worden.

Station 7
Park 4
Lesen statt hören
Vergangenheit und Zukunft des Hofgartens
Ich bin ein Teil dieses Gartens, solange ich denken kann, vielleicht sogar länger, als meine Urgroßväter hier gewirkt haben. Dieses Haus, Park 4, es ist mehr als nur Stein und Holz – es ist mein Zuhause, unser aller Zuhause, der Generationen von Gärtnern, die diesen Flecken Erde gehegt und gepflegt haben. Schon 1680, das weiß ich von alten Plänen, da stand es schon, ein bescheidenes Walmdachhaus, mitten im Herzen des barocken Herrengartens.
Die Zeiten haben sich gewandelt, das kann ich euch sagen. Aus den einfachen Häusern entlang der Leopoldstraße wurden schmuckere Bauten, die feinen Herrschaften wollten ihre Gärten bis an den Hofgarten heranreichen lassen. Ich erinnere mich noch gut an die Zeit vor der Sanierung ’95. Die Gärten, einst so stolz, waren verwildert, zugewuchert. Alte Schuppen standen im Weg, die Grundstücke ein einziges Durcheinander.
Aber wir Gärtner sind zäh. Und so kam es, dass sich die Dinge zum Besseren wendeten. Eine neue Garage für die Anwohner, die Häuser ringsum erstrahlten in neuem Glanz. Und unser altes Hofgärtnerhaus? Es hat eine Seele, das spürt man.
Ich erinnere mich an die Geschichten meines Großvaters von Herrn Oscar Arnold, um 1920. Der wollte unser Haus umbauen, es moderner machen. Da gab es Aufregung mit den Behörden, die Baugenehmigung kam erst später. Aber dann, 1922, ging es los! Die besten Gartenbautechniker aus ganz Deutschland kamen hierher, um das Gelände neu zu gestalten. Herr Arnold war stolz auf das, was er für Coburg schuf, auch wenn die Pflege des Gartens ihn viel Geld und Mühe kostete – zwei Mann waren ständig damit beschäftigt!
Dann, 1927, kaufte die Stadt Coburg das Haus. Es bekam ein neues Dach, die Fassade wurde gerichtet. Und 1996, das war ein Einschnitt, da wurde der südliche Anbau abgerissen und das Haus von Grund auf saniert. Aber wisst ihr, was mich besonders gefreut hat? Dass sie auch unsere alte Hofgartenmauer wiederhergestellt haben, die schon um 1680 hier stand. Die sorgfältig gearbeiteten Sandsteine, sie erzählen eine lange Geschichte.
Heute ist unser Haus ein schmuckes zweigeschossiges Gebäude mit einem besonderen Erker. Das Portal mit seinem flachen Bogen, der kleine Balkon mit den feinen Verzierungen, die Fenster im Dach – alles zeugt von den vielen Jahren, die es schon hier steht. Im Inneren haben sich alte Schätze erhalten: die knarrende Haustür, einige der alten Innentüren, der Kamin, die hölzernen Wand- und Deckenverkleidungen.